|
 |
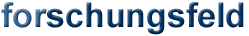  |
 |
 |
|
Kulturen
im Postsozialismus: Voraussetzungen und Veränderungen |
| Zielsetzungdc |
Die
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungen in
den postsozialistischen Ländern stehen in aller Regel im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Ihre unmittelbare
Relevanz, etwa bei Rechtsunsicherheit in wirtschaftlichen
Transaktionen mit Osteuropa, die sogleich größte Risiken für
die beteiligten Partner aus dem Westen mit sich bringen, steht
außer Zweifel.

 Nicht weniger außer Zweifel steht aber die Relevanz von
kulturellen Veränderungen für wirtschaftliche, rechtliche und
politische Fortschritte in den postsozialistischen Staaten.
Diese Bedeutung der kulturellen Veränderungen wird dadurch
virulent, dass sie mittelbar ist und deshalb gerne unterschätzt
wird. Doch wie wenig z.B. neue Verfassungsnormen mit der
Rechtswirklichkeit Russlands zu tun haben, erklärt sich aus der
Tradition der übermächtigen Stellung des einen Herrschers im
Lande. Die nachgeordnete Rolle von Parteien, die demokratischen
Entwicklungen entgegensteht, lässt Unwägbarkeiten bei
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kontakten ins
Unerträgliche steigen.
Nicht weniger außer Zweifel steht aber die Relevanz von
kulturellen Veränderungen für wirtschaftliche, rechtliche und
politische Fortschritte in den postsozialistischen Staaten.
Diese Bedeutung der kulturellen Veränderungen wird dadurch
virulent, dass sie mittelbar ist und deshalb gerne unterschätzt
wird. Doch wie wenig z.B. neue Verfassungsnormen mit der
Rechtswirklichkeit Russlands zu tun haben, erklärt sich aus der
Tradition der übermächtigen Stellung des einen Herrschers im
Lande. Die nachgeordnete Rolle von Parteien, die demokratischen
Entwicklungen entgegensteht, lässt Unwägbarkeiten bei
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kontakten ins
Unerträgliche steigen.

 Das Projekt zu den kulturellen Voraussetzungen und Veränderungen
erforscht deshalb Kontinuitäten und Diskontinuitäten der
gesellschaftlichen Entwicklung. Dabei kommt heute der
Herausbildung von Merkmalen moderner Zivilgesellschaften in den
Transformationsländern eine zentrale Rolle zu. Erst stabile
Zivilgesellschaften vermögen langfristig die Stabilität der
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Beziehungen zu den
Transformationsländern zu garantieren, nicht aber Verfassungen,
die keiner politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit
entsprechen. Erst wenn die in der Geschichte vorhandenen
Traditionen der civil societies, aber auch deren aktuelle
Defizite und (neue) Gefährdungen aufgezeigt werden, kann der
Westen berechenbare Partner finden und gezielte Unterstützung
leisten.
Das Projekt zu den kulturellen Voraussetzungen und Veränderungen
erforscht deshalb Kontinuitäten und Diskontinuitäten der
gesellschaftlichen Entwicklung. Dabei kommt heute der
Herausbildung von Merkmalen moderner Zivilgesellschaften in den
Transformationsländern eine zentrale Rolle zu. Erst stabile
Zivilgesellschaften vermögen langfristig die Stabilität der
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Beziehungen zu den
Transformationsländern zu garantieren, nicht aber Verfassungen,
die keiner politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit
entsprechen. Erst wenn die in der Geschichte vorhandenen
Traditionen der civil societies, aber auch deren aktuelle
Defizite und (neue) Gefährdungen aufgezeigt werden, kann der
Westen berechenbare Partner finden und gezielte Unterstützung
leisten.

 Der Kernbereich der Forschung umfasst deshalb die
Zivilgesellschaften und den aktuellen Identitätswandel in den
"Transformationsländern". Dieser basiert auf
Konstrukten von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Von Relevanz ist
dabei der Bruch, aber auch die Kontinuität von sozialistischer
und postsozialistischer Wahrnehmung.
Der Kernbereich der Forschung umfasst deshalb die
Zivilgesellschaften und den aktuellen Identitätswandel in den
"Transformationsländern". Dieser basiert auf
Konstrukten von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Von Relevanz ist
dabei der Bruch, aber auch die Kontinuität von sozialistischer
und postsozialistischer Wahrnehmung.

 Die neuen Zivilgesellschaften und der Identitätswandel werden
innerhalb der Länder, außerhalb, etwa in der Emigration, aber
auch in der Interaktion zwischen den Ländern untersucht. Drei
Aspekte bzw. Ziele stehen im Vordergrund:
Die neuen Zivilgesellschaften und der Identitätswandel werden
innerhalb der Länder, außerhalb, etwa in der Emigration, aber
auch in der Interaktion zwischen den Ländern untersucht. Drei
Aspekte bzw. Ziele stehen im Vordergrund:
1. Identitätswechsel auf dem Weg zur Zivilgesellschaft: das
Individuum in seinem Wandel vom Objekt staatlichen Handelns zum
Subjekt (religiös-ethische, historische Identität;
individuelle Wahrnehmung des anderen).
2. Konfliktpotentiale und Konfliktvermeidung: Spannung zwischen
nationaler und postnationaler (zivilisatorischer)
"Wiedergeburt" (Pluralismus der Kulturtypen, der
Kirchen, Sprachen, Geschichtskonzepte).

3. Individuell-differenzierte Sicht der Transformationsländer
durch den Westen (Evolution wechselseitiger Wahrnehmungen
West/Ost; Ende nationaler Stereotypen).

|
 Leiter Leiter |
Prof.
Dr. Walter Koschmal
 |
| Teilprojekte |
Das
Bild Europas in den Schulbüchern der Ukraine |
 |
Das
Deutschland- und das Russlandbild in der polnischen
Nachkriegsliteratur im Spannungsgefüge zwischen Bruch und
Kontinuität |
|
Die
Rolle der Geschichte und des Geschichtsbewußtseins in der Ukraine nach dem
Zerfall der Sowjetunion
|
 |
Kirchen
im Spannungsfeld politischer Transformationen. Soziokulturelle Wirkungsgefüge
der Kirchen in der Ukraine von 1944 bis zur Gegenwart
|
|
Kulturverständnis
im postsozialistischen Rußland. Modelle und Traditionen.
|
 |
Sprach-,
und Kulturwechsel in Mittel- und Osteuropa (nach 1968) als Modelle
transnationaler Identitäten
|
|
Untersuchungen zum
Sprachbewußtsein in Kroatien
|
 |
 
|
|